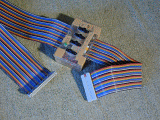Wie alles begann -
Mein erster Computer -
Mein zweiter Computer -
Meine PCs
 Mein erster Computer:
Mein erster Computer:
Sharp MZ-80K
Als ich meinen ersten Job hatte, dachte ich gleich daran, mir einen
Computer zu kaufen - doch wozu? Mir fiel kein Verwendungszweck ein,
also ließ ich es. Bis ich auf der Hannover-Messe jemanden sah,
der "Elektronische Butler" konstruierte: mannsgroße
Roboter, die herumfuhren und Getränke anboten. Ein
Ultraschall-Sensor verhinderte Zusammenstöße. Gleich kam
mir der Gedanke, diese Idee zu perfektionieren; man müsste in
jedem Raum zwei Ultraschall-Quellen anbringen, und mit Hilfe von
Laufzeitmessungen und Dreiecksberechnungen müsste der Roboter
seinen genauen Standort bestimmen können. Und um so etwas zu
realisieren, brauche ich einen Computer!
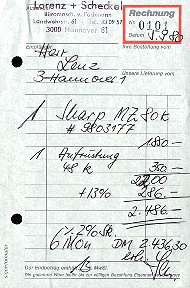 Ich fand zwei Computer, die mir die richtigen zu sein schienen: der
legendäre Commodore PET und der Sharp MZ-80K. Für letzeren
entschied ich mich aus zwei Gründen: erstens konnte er deutsche
Umlaute darstellen, und zweitens war sein BASIC nicht fest im
Speicher eingebrannt, sondern per Cassette ladbar, was (so war meine
weitblickende Vermutung) Manipulationen daran vereinfachen sollte.
Dass ich mich damit auch für ein Z-80-System und gegen ein
6502-System entschied, war mir damals natürlich überhaupt
nicht klar - aber auch diese Entscheidung halte ich immer noch
für gut und richtig, jawohl!
Ich fand zwei Computer, die mir die richtigen zu sein schienen: der
legendäre Commodore PET und der Sharp MZ-80K. Für letzeren
entschied ich mich aus zwei Gründen: erstens konnte er deutsche
Umlaute darstellen, und zweitens war sein BASIC nicht fest im
Speicher eingebrannt, sondern per Cassette ladbar, was (so war meine
weitblickende Vermutung) Manipulationen daran vereinfachen sollte.
Dass ich mich damit auch für ein Z-80-System und gegen ein
6502-System entschied, war mir damals natürlich überhaupt
nicht klar - aber auch diese Entscheidung halte ich immer noch
für gut und richtig, jawohl!
Am 5.9.1980 zog der MZ-80K in meine Wohnung ein. Da die
48-kB-Speichererweiterung gerade zum Sonderpreis von nur
350 DM angeboten wurde, hatte ich sie gleich mitbestellt.
(Für diesen Betrag bekommt man heute locker 256 MB, also
mehr als das 5000-fache...) Einen Schaltplan des Gerätes
hatte ich mir natürlich auch mitgeben lassen.
Der MZ-80K war schon eine verdammt pfiffige Kiste. Das integrierte
Cassettenlaufwerk speicherte Programme und Daten, der eingebaute
Lautsprecher konnte Töne von sich geben. Das Sharp-BASIC war so
genial, dass es sogar möglich war, Programme abzubrechen, Zeilen
zu ändern und das Programm mit dem Befehl "CONT"
einfach fortsetzen zu lassen. Das Commodore-BASIC, mit dem ich mich
später im Büro (CBM 8296) herumschlagen musste, war dazu
nicht leider fähig, die Programme mussten nach jeder kleinsten
Änderung ganz neu gestartet werden...
|
Schiffeversenken
|
Labyrinth
|
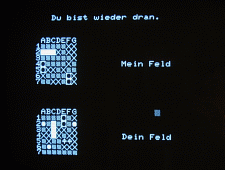
|
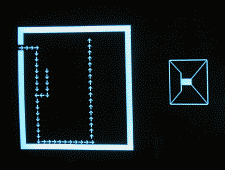
|
Nun wurde erst mal fleißig programmiert. Wobei ich mich auch
ganz modernen Themen zuwandte: künstliche Intelligenz und
virtuelle Realität. Das Programm "Schiffeversenken"
(Computer gegen Mensch) schoss nicht nur wahllos durch die Gegend,
sondern versuchte bei einem Treffer auf ein großes Schiff, den
Rest des Schiffes durch systematisches Einkreisen zu versenken. Das
Programm "Labyrinth" entwarf ein zufälliges System
aus geheimen Gängen, die in einer zweidimensionalen Matrix
gespeichert waren. Nach jedem Schritt des Spielers analysierte es
die Felder, die den Spieler umgaben, und entwickelte daraus ein
perspektivisches Bild (im Foto eine Biegung nach links).
Aber auch die Hardware begann mich zu interessieren. Da hatte ich
eine Menge Neues zu lernen. Nach dem Einschalten des Computers wurde
immer erst mal der Arbeitsspeicher gelöscht. Lange Zeit
studierte ich den Schaltplan, um herauszufinden, auf welchem Pin die
Speicherbausteine den Lösch-Impuls bekamen... bis mir irgendwann
klar wurde, dass eine Routine ganz simpel eine Adresse nach der
Anderen auf Null setzt. Und irgendwann wusste ich dann auch, was ein
Mikroprozessor ist und dass in meinem Computer ein solcher steckte.
Banale Erkenntnisse - aber für einen "Elektroniker"
wie mich zuerst mal gar nicht selbstverständlich.
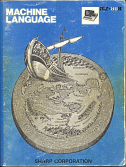 Größtes Interesse erregte natürlich auch die
Anschlussbuchse, die hinten angebracht war. Anhand des Schaltplans
stellte ich fest, dass sie mehr oder weniger direkt mit dem Z-80
verbunden war - dass man also nicht so einfach andere Geräte
damit ansteuern konnte. Es galt also, sich mit der Maschinensprache
des Z-80 zu befassen. Im Dezember 1981 kaufte ich das Buch
"Machine Language" mit einer Cassette, auf der sich eine
Art Debugger befand. Damit konnte man Hex-Code eingeben, listen,
bearbeiten und vieles mehr. Nachdem es mir gelungen war, die Sperre
auszuschalten, die das Debuggen des Betriebssystems verhinderte,
erforschte ich dieses. Es entstanden viele Seiten mit per Hand
disassembliertem Code, wobei ich eine Menge über
Z-80-Programmierung lernte. Mit Hilfe eines weiteren Buches lernte
ich, wie der Z-80 arbeitete und mit Hilfe von IORQ, MREQ etc. seine
Umgebung ansteuerte. Da war es dann nicht mehr schwierig, ein kleines
Interface zusammenzulöten, mit dem ich z.B. Geräte ein- und
ausschalten konnte.
Größtes Interesse erregte natürlich auch die
Anschlussbuchse, die hinten angebracht war. Anhand des Schaltplans
stellte ich fest, dass sie mehr oder weniger direkt mit dem Z-80
verbunden war - dass man also nicht so einfach andere Geräte
damit ansteuern konnte. Es galt also, sich mit der Maschinensprache
des Z-80 zu befassen. Im Dezember 1981 kaufte ich das Buch
"Machine Language" mit einer Cassette, auf der sich eine
Art Debugger befand. Damit konnte man Hex-Code eingeben, listen,
bearbeiten und vieles mehr. Nachdem es mir gelungen war, die Sperre
auszuschalten, die das Debuggen des Betriebssystems verhinderte,
erforschte ich dieses. Es entstanden viele Seiten mit per Hand
disassembliertem Code, wobei ich eine Menge über
Z-80-Programmierung lernte. Mit Hilfe eines weiteren Buches lernte
ich, wie der Z-80 arbeitete und mit Hilfe von IORQ, MREQ etc. seine
Umgebung ansteuerte. Da war es dann nicht mehr schwierig, ein kleines
Interface zusammenzulöten, mit dem ich z.B. Geräte ein- und
ausschalten konnte.
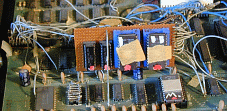
|
senkrecht stehend: die EPROMS
mit dem Debugger, davor ("M.") das
Betriebssystem - das auch längst
verbessert und erweitert worden war.
|
Außerdem stellte ich fest, dass der gesamte
Adressenbereich E000 bis EFFF nur zur Steuerung der Hardware
(Tastatur, Cassette, Timer etc.) diente. Welch eine Verschwendung!
Ich baute also zusätzliche Chips ein, um die Adressen zu
decodieren, lötete mir einen EPROM-Brenner zusammen, schrieb ein
Programm, das den Debugger in den Adressraum E200 verschob, brannte
das Ergebnis auf zwei EPROMs und lötete diese in meinen Computer
ein. Von da ab genügte ein Tastendruck, um den (inzwischen durch
etliche Zusatzroutinen erweiterten) Debugger zu starten.
Zu dieser Zeit fotografierte ich sehr viel, und meine Freunde
bestellten massenweise Abzüge - manchmal mehr als zweihundert.
Ein BASIC-Programm half mir, die Bestellungen zu erfassen, die Anzahl
der Kopien pro Negativ zu ermitteln und nachher die Abzüge
den Bestellern zuzuordnen. Bloß das Ausfüllen der
Bestell-Liste war nervig, weil ich all die Zahlen vom Bildschirm
abschreiben musste. Wie viel bequemer wäre es doch, wenn der
Computer mir die Zahlen einfach diktieren würde! Also musste er
sprechen lernen. Ich lötete mir einen Analog-Digital-Wandler
zusammen (ein einfacher Operationsverstärker, die Ansteuerung
und Auswertung übernahm der Computer), der natürlich viel
zu langsam war - aber ich nahm die Zahlwörter einfach auf
Tonband mit 19 cm/sec auf und ließ sie mit 4,75 cm/sec
abspielen. Die digitalisierten Wörter wurden als Daten auf
Cassette gespeichert. In den Computer lötete ich ein
Widerstandsnetzwerk als Digital-Analog-Wandler ein - fertig.
Nichts ist so perfekt, als dass es nicht verbessert werden konnte -
auch nicht der MZ-80K. Erst mal sägte ich ein Loch in das
Bildschirmgehäuse und baute einen Lautstärkeregler ein,
damit die akustischen Signale nicht mehr so laut waren. Auch ein
Reset-Taster fand dort seinen Platz. Dann bekam ich Kontakt zu einem
MZ-80K-Club in Hamburg. Dort kursierte eine Bastelanleitung, wie man
die Geschwindigkeit der Kiste verdoppeln kann: die CPU wurde gegen
einen Z-80A ausgetauscht, diesem wurde durch Aufkratzen von
Leiterbahnen und Einfügen einiger ICs eine Taktfrequenz von
4 MHz zugeführt, und jemand verkaufte auch das passende Rad
für den Antrieb des Cassettenlaufwerks, damit dieses sich auch
doppelt so schnell drehte.
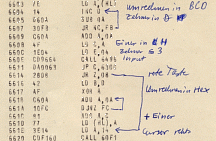 Über diesen Club erstand ich auch meinen ersten
"Drucker": einen alten Fernschreiber Siemens 100, der
einen ohrenbetäubenden Lärm machte, aber dank seiner
Großbuchstaben ein für Listings angenehmes Schriftbild
hatte. Jemand aus dem Club hatte mir auch einen Disassembler gegeben.
Nun konnte ich endlich meine Programme ausdrucken und musste nur noch
die Kommentare per Hand hinzufügen. Aber verdammt langsam war er
doch, und das hieß immer warten, bis er fertig war. Also baute
ich einen Spooler hinzu. Ein eigenständiges Z-80-System steuerte
den Drucker an, nachdem es über ein ausgeklügeltes System
von Interrupts und Datenaustausch per DMA die zu druckenden Zeichen
von meinem Computer übernommen hatte. Dafür waren
natürlich entsprechende Änderungen im Betriebssystem und
auf der BASIC-Cassette notwendig gewesen. Außerdem genügte
ein Druck auf eine Taste am Gehäuse des Spoolers, dass der
Computer den Inhalt des Videospeichers hinüberschickte, und
während ich am Computer weiter arbeiten konnte, machte der
Fernschreiber einen Bildschirmausdruck.
Über diesen Club erstand ich auch meinen ersten
"Drucker": einen alten Fernschreiber Siemens 100, der
einen ohrenbetäubenden Lärm machte, aber dank seiner
Großbuchstaben ein für Listings angenehmes Schriftbild
hatte. Jemand aus dem Club hatte mir auch einen Disassembler gegeben.
Nun konnte ich endlich meine Programme ausdrucken und musste nur noch
die Kommentare per Hand hinzufügen. Aber verdammt langsam war er
doch, und das hieß immer warten, bis er fertig war. Also baute
ich einen Spooler hinzu. Ein eigenständiges Z-80-System steuerte
den Drucker an, nachdem es über ein ausgeklügeltes System
von Interrupts und Datenaustausch per DMA die zu druckenden Zeichen
von meinem Computer übernommen hatte. Dafür waren
natürlich entsprechende Änderungen im Betriebssystem und
auf der BASIC-Cassette notwendig gewesen. Außerdem genügte
ein Druck auf eine Taste am Gehäuse des Spoolers, dass der
Computer den Inhalt des Videospeichers hinüberschickte, und
während ich am Computer weiter arbeiten konnte, machte der
Fernschreiber einen Bildschirmausdruck.
Dieses Z-80-System war nicht das einzige:
|
Meine zweite Uhr lief mit einem Z-80.
|
|
Über einen Bekannten geriet ein Hobby-Fledermausforscher
an mich, der dringend ein Fledermaus-Zählgerät brauchte.
Das Mikroprozessorsystem wertete zwei Lichtschranken aus, durch die
die Fledermäuse fliegen mussten, wobei die Flugrichtung sowie
Datum und Uhrzeit festgehalten wurden. Die Daten konnte man
hinterher per Tastendruck auf LED-Ziffern anzeigen lassen.
|
|
Bei meiner neuen Stereo-Anlage mit Fernbedienung verzichtete
ich auf den CD-Player. So waren vier Tasten auf der
Fernbedienung übrig. Ich schloss ein Z-80-System an den
Infrarot-Empfänger der Anlage an, das die Signale decodiert
und bei Erkennen dieser vier Tasten meine Wohnzimmerbeleuchtung
steuert. Das Programm hatte ich so geschrieben, dass es völlig
ohne RAM auskam, was eine Menge Löt-Arbeit sparte (und mit
einem 6502 unmöglich gewesen wäre).
|
|
Natürlich werkelte auch ein Z-80 in meiner patentierten
CD-Abspiel-Programmierung.
|
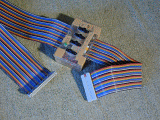
Für die Entwicklung all dieser Systeme war mein selbstgebauter
In-Circuit-Emulator sehr hilfreich: das eine Ende des Kables steckte
ich in die Buchse des MZ-80K, die andere in den Sockel in dem zu
entwickelnden System, der die CPU aufnehmen sollte. Das heißt,
mein Computer emulierte die CPU. Ich konnte also all die Programme
schreiben (jawohl, alles in Hex-Ziffern eingetippt!), testen, debuggen
und direkt in der angelöteten Peripherie testen. Über die
Schalter in dem Plastikkästchen konnte ich eventuell störende
Signale wie MREQ abschalten, denn der Computer konnte ja nicht seinen
eigenen Speicher und den eingelöteten gleichzeitig benutzen.
Höhepunkt meiner MZ-80K-Zeit war auf jeden Fall mein Auftritt in
der Sendung "Mit Schraubstock und Geige", wo der Computer
vollautomatisch meine Eier-Aufschneide-Maschine
ansteuerte.
Mit solchen Basteleien verging die Zeit. Neuartige Erfindungen
machten sich breit, so zum Beispiel ein Medium namens "Floppy
Disk", auf dem man Daten in ungeahnter Geschwindigkeit speichern
können sollte. Also auf zu neuen Ufern!
Besonders angenehm war das Arbeitsgeräusch des Fernschreibers
natürlich nicht. Im Dezember 1985 (mein zweiter Computer war schon
in Arbeit) kaufte ich mir für 1.198,00 DM den TAXAN KP810,
einen Matrixdrucker mit 9 Nadeln. Besonders im Schönschreibmodus
hatte er ein wunderbares Schriftbild, aber das dauerte dann schon ein
bisschen, weil er über jede Zeile viermal drüberfuhr.
Ach ja: den ultraschallgesteuerten Roboter habe ich niemals ernstlich
angefangen. So eine Laufzeitmessung in ausreichender Genauigkeit
stellte ich mir sehr kompliziert vor, und ich hatte immer andere
Projekte im Kopf, die sich einfacher und schneller verwirklichen
ließen...
Der MZ-80K ist natürlich immer noch voll funktionsfähig
und steuerte die (mit einiger Arbeit wieder flott gemachte)
Eier-Aufschneide-Maschine im April 2000 auf dem
Vintage Computer Festival Europa.
weiter
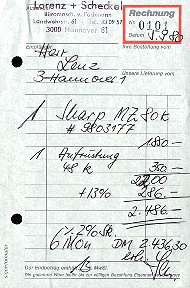 Ich fand zwei Computer, die mir die richtigen zu sein schienen: der
legendäre Commodore PET und der Sharp MZ-80K. Für letzeren
entschied ich mich aus zwei Gründen: erstens konnte er deutsche
Umlaute darstellen, und zweitens war sein BASIC nicht fest im
Speicher eingebrannt, sondern per Cassette ladbar, was (so war meine
weitblickende Vermutung) Manipulationen daran vereinfachen sollte.
Dass ich mich damit auch für ein Z-80-System und gegen ein
6502-System entschied, war mir damals natürlich überhaupt
nicht klar - aber auch diese Entscheidung halte ich immer noch
für gut und richtig, jawohl!
Ich fand zwei Computer, die mir die richtigen zu sein schienen: der
legendäre Commodore PET und der Sharp MZ-80K. Für letzeren
entschied ich mich aus zwei Gründen: erstens konnte er deutsche
Umlaute darstellen, und zweitens war sein BASIC nicht fest im
Speicher eingebrannt, sondern per Cassette ladbar, was (so war meine
weitblickende Vermutung) Manipulationen daran vereinfachen sollte.
Dass ich mich damit auch für ein Z-80-System und gegen ein
6502-System entschied, war mir damals natürlich überhaupt
nicht klar - aber auch diese Entscheidung halte ich immer noch
für gut und richtig, jawohl!

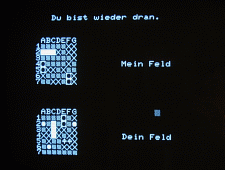
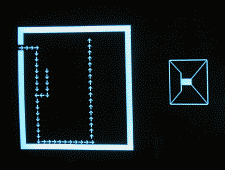
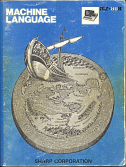 Größtes Interesse erregte natürlich auch die
Anschlussbuchse, die hinten angebracht war. Anhand des Schaltplans
stellte ich fest, dass sie mehr oder weniger direkt mit dem Z-80
verbunden war - dass man also nicht so einfach andere Geräte
damit ansteuern konnte. Es galt also, sich mit der Maschinensprache
des Z-80 zu befassen. Im Dezember 1981 kaufte ich das Buch
"Machine Language" mit einer Cassette, auf der sich eine
Art Debugger befand. Damit konnte man Hex-Code eingeben, listen,
bearbeiten und vieles mehr. Nachdem es mir gelungen war, die Sperre
auszuschalten, die das Debuggen des Betriebssystems verhinderte,
erforschte ich dieses. Es entstanden viele Seiten mit per Hand
disassembliertem Code, wobei ich eine Menge über
Z-80-Programmierung lernte. Mit Hilfe eines weiteren Buches lernte
ich, wie der Z-80 arbeitete und mit Hilfe von IORQ, MREQ etc. seine
Umgebung ansteuerte. Da war es dann nicht mehr schwierig, ein kleines
Interface zusammenzulöten, mit dem ich z.B. Geräte ein- und
ausschalten konnte.
Größtes Interesse erregte natürlich auch die
Anschlussbuchse, die hinten angebracht war. Anhand des Schaltplans
stellte ich fest, dass sie mehr oder weniger direkt mit dem Z-80
verbunden war - dass man also nicht so einfach andere Geräte
damit ansteuern konnte. Es galt also, sich mit der Maschinensprache
des Z-80 zu befassen. Im Dezember 1981 kaufte ich das Buch
"Machine Language" mit einer Cassette, auf der sich eine
Art Debugger befand. Damit konnte man Hex-Code eingeben, listen,
bearbeiten und vieles mehr. Nachdem es mir gelungen war, die Sperre
auszuschalten, die das Debuggen des Betriebssystems verhinderte,
erforschte ich dieses. Es entstanden viele Seiten mit per Hand
disassembliertem Code, wobei ich eine Menge über
Z-80-Programmierung lernte. Mit Hilfe eines weiteren Buches lernte
ich, wie der Z-80 arbeitete und mit Hilfe von IORQ, MREQ etc. seine
Umgebung ansteuerte. Da war es dann nicht mehr schwierig, ein kleines
Interface zusammenzulöten, mit dem ich z.B. Geräte ein- und
ausschalten konnte.
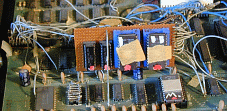

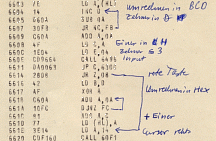 Über diesen Club erstand ich auch meinen ersten
"Drucker": einen alten Fernschreiber Siemens 100, der
einen ohrenbetäubenden Lärm machte, aber dank seiner
Großbuchstaben ein für Listings angenehmes Schriftbild
hatte. Jemand aus dem Club hatte mir auch einen Disassembler gegeben.
Nun konnte ich endlich meine Programme ausdrucken und musste nur noch
die Kommentare per Hand hinzufügen. Aber verdammt langsam war er
doch, und das hieß immer warten, bis er fertig war. Also baute
ich einen Spooler hinzu. Ein eigenständiges Z-80-System steuerte
den Drucker an, nachdem es über ein ausgeklügeltes System
von Interrupts und Datenaustausch per DMA die zu druckenden Zeichen
von meinem Computer übernommen hatte. Dafür waren
natürlich entsprechende Änderungen im Betriebssystem und
auf der BASIC-Cassette notwendig gewesen. Außerdem genügte
ein Druck auf eine Taste am Gehäuse des Spoolers, dass der
Computer den Inhalt des Videospeichers hinüberschickte, und
während ich am Computer weiter arbeiten konnte, machte der
Fernschreiber einen Bildschirmausdruck.
Über diesen Club erstand ich auch meinen ersten
"Drucker": einen alten Fernschreiber Siemens 100, der
einen ohrenbetäubenden Lärm machte, aber dank seiner
Großbuchstaben ein für Listings angenehmes Schriftbild
hatte. Jemand aus dem Club hatte mir auch einen Disassembler gegeben.
Nun konnte ich endlich meine Programme ausdrucken und musste nur noch
die Kommentare per Hand hinzufügen. Aber verdammt langsam war er
doch, und das hieß immer warten, bis er fertig war. Also baute
ich einen Spooler hinzu. Ein eigenständiges Z-80-System steuerte
den Drucker an, nachdem es über ein ausgeklügeltes System
von Interrupts und Datenaustausch per DMA die zu druckenden Zeichen
von meinem Computer übernommen hatte. Dafür waren
natürlich entsprechende Änderungen im Betriebssystem und
auf der BASIC-Cassette notwendig gewesen. Außerdem genügte
ein Druck auf eine Taste am Gehäuse des Spoolers, dass der
Computer den Inhalt des Videospeichers hinüberschickte, und
während ich am Computer weiter arbeiten konnte, machte der
Fernschreiber einen Bildschirmausdruck.